 |
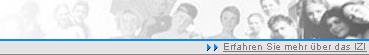 |
|
 Publikationen Publikationen  TELEVIZION TELEVIZION  Ausgabe
15/2002/1 Ausgabe
15/2002/1 |
||||||||||||||||
Ruth Etienne Klemm Zur Entstehung innerer Bilder – Ein Überblick Innere Bilder entstehen aus der Erfahrung, sind immer mit Gefühlen verbunden und eng an Interaktionen geknüpft. Die Fähigkeit des "Bilderns" ist dem Menschen angeboren und beginnt bereits im Säuglingsalter. Daher hat das Fernsehen nicht die Kraft, die Kinder "auszubildern", doch trägt es eine hohe Verantwortung für unterstützende und nicht behindernde Bilder. Hat das Fernsehen die Macht und die negative Kraft, die Kinder "auszubildern"? Um dieser Frage einige Überlegungen hinzuzufügen, lohnt sich die Beschäftigung damit, wie eigentlich innere Bilder entstehen und auf welche Art und Weise diese (im Negativen wie im Positiven) durch das Fernsehen beeinflusst werden können. Zunächst möchte ich Sie einladen, sich beim Lesen selbst möglichst viele lebhafte und farbige eigene innere Bilder zu machen. Ich beginne mit einer kleinen Quizfrage: "Was hat ein dunkleres Grün – eine gefrorene Erbse oder ein Tannenzweig im Winter?" Es handelt sich hierbei sicher nicht um eine Frage der Allgemeinbildung. Vielmehr ist es eine Anregung, sich bewusst werden zu lassen, auf welchem Weg wir im Alltag solche nicht memorierbaren Fragen zu beantworten pflegen: Wir formen ganz selbstverständlich und spontan ein Vorstellungsbild – Sie haben sich die Erbse und den Tannenzweig vor Ihrem inneren Auge aufsteigen lassen – und bedienen uns somit einer spezifisch menschlichen Fähigkeit. Ihr Vorstellungsbild knüpft an eine Alltagserfahrung an und beruht auf Erfahrung (hier mit einer gefrorenen Erbse und einem Tannenzweig im Winter) sowie auf Anschaulichkeit, d.h. Sie brauchten zuerst eine äußere Anschauung, um zu einer inneren zu kommen. Sie gebrauchen das Gedächtnis, um sich daran zu erinnern und um die Erinnerung hervorholen zu können. Die menschliche Strukturierungsfähigkeit, eine Funktion des Verstands, stellt schließlich das richtige Verhältnis zwischen der Erbse und dem Tannenzweig her. Sie sehen, anhand dieses kleinen Quiz sind wir mitten im Thema – und einige wesentliche Aspekte der inneren Bilder werden deutlich: Wir bedienen uns dieser spezifisch menschlichen Fähigkeit, uns etwas vorzustellen, automatisch und im Alltag praktisch ununterbrochen. Wir machen uns Bilder. Schon der Sprachgebrauch macht dies deutlich. So habe ich Sie vorhin eingeladen, "sich möglichst lebhafte Bilder zu machen" oder wir sagen etwa: "Jetzt stell Dir doch mal vor, dass....". Wir haben einen Gedankenblitz, eine Eingebung, wir drücken einen Sachverhalt über ein Bild aus und sagen: "viele Wege führen nach Rom" oder "etwas kommt uns chinesisch vor" usw. Aller Anfang ist die Erfahrung "Bildern" ist ein urmenschliches Verhaltensmuster – ein Phänomen, mit dem sich noch vor den Psychologen die Philosophen auseinander gesetzt haben (Etienne Klemm 1999, S. 9 ff.). Kant formulierte es prägnant: Alle Erkenntnis beginnt mit der Erfahrung. Erfahren tut man etwas sinnlich, leiblich, motorisch, visuell, akustisch, und zwar dadurch, dass man lebhaft im eigentlichen und übertragenen Sinne nach etwas greift, um es zu begreifen (Eisler 1994, S. 134). Alles Denken beginnt mit den Bildern – mit der Anschauung. Sigmund Freud war der Erste, der entdeckt hat, dass wir über zwei verschiedene Denkprozesse verfügen: Zum einen über das primär-prozesshafte, das Denken in Bildern: bildhaft, ganzheitlich, intuitiv-imaginativ. Zum anderen über das sekundär-prozesshafte, das rational-begriffliche Denken (Salvisberg 1997, S. 77). Jean Paul Sartre hat dies aufgegriffen und dem Denken in Bildern eine berühmte Abhandlung, L’imaginère (1940), gewidmet. Ihm verdanken wir das Wissen um die wechselseitige Abhängigkeit, die so genannte Interdependenz zwischen dem imaginativen Denken in Bildern und dem konkret-realen Denken in Begriffen. Wir können konkret nur dank dem bildhaften Denken und den Vorstellungen denken, und wir können unsere Vorstellungen und Bilder nur dank dem begrifflichen Denken beschreiben und reflektieren. Über das Imaginäre kann der Mensch die Realität übersteigen, das Imaginäre beflügelt unsere Gedanken und suggeriert Freiheit und Kreativität. Und so sagen wir denn: die Gedanken sind frei oder eben: die Bilder sind frei. Bei allen Vorstellungsbildern spielt das Gedächtnis (ein nonverbales – nicht sprachliches – und ein verbales – sprachliches Gedächtnis) eine zentrale Rolle. Und schließlich bedarf alle Vorstellung des ordnenden, strukturierenden Verstandes (neben der Intuition mit ihrem schlagartigen Erfassen), der immer wieder ein sinnvolles Verhältnis zwischen Erfahrung, dem sinnlich vorgestellten Gegenstand und seinem Begriff herzustellen versucht. Über den Verstand findet der Mensch den richtigen Zusammenhang und kann seine Erfahrungen einordnen und ablegen. Alle Vorstellung ist mit Gefühlen verbunden Alle Erfahrungen sind gefühlsmäßig besetzt. Mit den inneren Bildern von Erbse und Tannenzweig sind auch Stimmungen und Gefühle verbunden und als kleine Szenen aufgetaucht. Alle Erinnerung taucht mit ihren ursprünglichen Gefühlen auf, weshalb all unsere erinnerte Erfahrung und all unsere Vorstellungen immer auch gefühlsmäßig besetzt sind. Auch auf diesen Umstand haben die beiden genannten Philosophen schon vor vielen Jahrzehnten hingewiesen und festgehalten: Jede Wahrnehmung und jede Vorstellung ist von einer affektiven Reaktion begleitet, weil wir die Welt über unsere Gefühle als einheitlich erleben können. Die Entwicklungspsychologie und ihre Grundlagenforschung bestätigt diesen Zusammenhang, und auch die neurobiologische / neurophysiologische Forschung, die mittlerweile einen genauen Grundriss der Hirnarchitektur und -struktur aufzeichnen konnte, erhärtet und belegt dies präzise und hat es populär gemacht durch viele Abhandlungen zur emotionalen Intelligenz: Den Gefühlen kommt für die Wahrnehmung, das Denken, Verstehen und die Alltagsbewältigung eine herausragende Bedeutung zu. Denken und Fühlen gehen in allen Lebenslagen zusammen: Es gibt kein Erkennen ohne Gefühl, kein Handeln, keine Wahrnehmung, keine Erinnerung ohne Gefühl etc. Ohne Gefühle ist ein Verstehen nicht möglich. Gefühle sind immer mit inneren Bildern verbunden, und deshalb gibt es auch keine Handlung, keine Erkenntnis, keine Wahrnehmung und keine Erinnerung ohne innere Bilder. Gefühle sind auch in allen Interaktionssituationen enthalten – seien diese sozial-zwischenmenschlicher Natur oder natürlicher, dinglicher oder auch virtueller Art – und als Beziehungsaspekt in allen Beziehungen. Damit sind fünf grundlegende Aspekte innerer Bilder deutlich geworden und kommen zum Tragen, ob es sich beim vorstellenden Menschen um ein Kleinkind, ein Schulkind, einen Jugendlichen oder um uns Erwachsene handelt:
Die Fähigkeit zu "inneren Bildern" ist dem Menschen angeboren Erstaunlich und spannend ist nun, dass der Mensch schon ab der Geburt in der Lage ist zu "bildern" – sich Bilder zu machen –, und dass er auch praktisch ab dem ersten Moment seines Lebens damit beginnt, sich Vorstellungen zu machen, denn alle notwendigen Voraussetzungen sind im Menschen angelegt/inhärent. Es gibt gute Gründe, davon auszugehen, dass es sogar Funktionen für das Schaffen von inneren Bildern gibt, wie z.B. das Wiedererkennungsgedächtnis, das schon vor der Geburt aktiv wird. Ein schönes (berühmtes) Beispiel ist der Musiker und Dirigent, der eine neue Partitur einstudierte, die er kannte, ohne sie bewusst kennen zu können. Wie sich herausstellte, spielte seine Mutter – während sie mit ihm schwanger war – diese auf ihrem Cello immer wieder, wodurch die Musik eine vorgeburtliche Gedächtnisspur hinterlassen hat. Was stimuliert nun den Menschen, sich Bilder zu machen? Was motiviert den Entstehungsprozess der inneren Bilder ? Um diesen Entstehungsprozess zu beleuchten, möchte ich mich kurz dem ganz kleinen Kind / dem Säugling zuwenden. Natürlich wissen wir alle, dass nicht die Säuglinge das Kinderfernsehpublikum sind, doch die Möglichkeit, innere Bilder zu haben, sie aufzubauen und zu nutzen, erfährt eine erste starke Prägung im Baby- und Kleinkindalter. Diese Zeit bedeutet für die Vorstellungsbilder eine so genannte sensible Phase und ist wesentlich für die Entstehungsgeschichte der inneren Bilder, auch wenn sich die inneren Bilder ein Leben lang weiterentwickeln. Aller Anfang ist die Erfahrung und aller Anfang sind die Bilder. Diese Erfahrungen und Bilder wollen geordnet sein. Der Mensch will seine Erfahrungen ordnen und strukturieren, um so Welterklärung zu finden und um seine Welt als einheitlich zu erleben. Ihm ist ein fundamentales Strukturierungsbedürfnis angeborenen. Als zweites großes Bedürfnis ist das Beziehungsbedürfnis im Menschen angelegt, d.h. das Bedürfnis, als soziales Wesen in soziale Beziehungen eingebunden zu sein, dieses Zusammensein immer wieder erschaffen und aufrecht erhalten zu können und sich von Lebendigem umgeben zu wissen, selbst dann, wenn man konkret alleine ist. Diese beiden Bedürfnisse veranlassen bereits den Säugling, mit dem "Bildern" anzufangen – in einen inneren Dialog mit sich selbst zu treten und alle Möglichkeiten dieser spezifisch menschlichen Fähigkeit auszunützen. Die ersten inneren Bilder sind Abbilder normaler, alltäglicher Interaktionserfahrungen. Sie haben sich –– noch vor dem Spracherwerb – ins Leibgedächtnis eingraviert und sind dort gespeichert, weshalb sie so nachhaltig wirken, auch wenn wir uns dessen kaum mehr bewusst sind. Diese inneren Bilder entwickeln sich weiter mit allen neu hinzukommenden Fähigkeiten und differenzieren sich aus, sodass immer mehr ein komplexes, aufgefächertes System von inneren Bildern anwächst und den Erwachsenen im Allgemeinen auszeichnet. Betrachten wir einen Säugling vor unserem
inneren Auge, dann sehen wir, dass dieser kleine Mensch nicht nur
abhängig und auf unsere Fürsorge angewiesen ist, sondern
selber bereits sehr aktiv und selbsttätig am Geschehen teilnimmt:
Das Zulächeln und Anstrahlen der Mutter, das staunende Betrachten
der eigenen Hände, der Hände der Mutter, das Greifen nach
den Gegenständen, das aufmerksame Lauschen auf alle Geräusche
und Töne, das eigene Glucksen und Kreischen, das erschreckte
Reagieren auf einen lauten und heftigen Wortwechsel usw. Es wird
schnell offensichtlich, dass sich das Baby mit sich, seinem Selbst-
und Körperbild, mit seinem Gegenüber als bedeutungsvollem
Anderen, als seiner Bezugsperson und damit mit seiner kleinen Welt
– oder Welt ganz allgemein – auseinander setzt. Es sammelt konkrete,
reale Erfahrungen mit jedem Atemzug und mit jedem Zusammensein.
Dabei wird es nicht etwa überschwemmt von all den Eindrücken.
Es ist nicht hilflos dem Strudel von Ereignissen und (abstrahierbaren)
Erlebnissen ausgeliefert, sondern es sortiert seine Erfahrungen
und versucht sie einzuordnen. Es ist ganz offensichtlich ein gut
ausgerüsteter Interaktionspartner, der die Reize bewältigen
kann, was ihn in die Lage versetzt, erfolgreich mit Eindrücken,
Erfahrungen, Wahrnehmungen, Stimuli aller Art umzugehen und fertig
zu werden. Zur angeborenen Grundausrüstung des Menschen – und
damit zur Voraussetzung für das "Bildern" – zählen laut
Daniel Stern, einem amerikanischen Säuglingsforscher (Stern
1994): 1. Ein früh funktionierendes nonverbales Gedächtnis Ab der Geburt funktioniert das Gedächtnis
(das motorische, perzeptive, affektive, reproduktive Leibgedächtnis
oder auch sensomotorische Schemata nach Piaget). Dieses Gedächtnis
ist nicht auf Sprache angewiesen – weder bei der Enkodierung noch
bei der Dekodierung. Es erkennt wieder und bestätigt auf diese
Weise die Erfahrungen und die Wahrnehmungen und damit die persönliche
Außen- und Innenwelt. 2. Die angeborene Fähigkeit zur ganzheitlichen amodalen Wahrnehmung Es ist eine Wahrnehmung, die nicht an einen
bestimmten Sinneskanal gebunden ist, sondern über verschiedene
Modalitäten (Sehen, Hören, Riechen, Fühlen und auf
der Ebene der Gefühle) gleichzeitig aufnehmen und speichern
kann. Es ist auch die Fähigkeit, durch die wir Wahrnehmungen
in Gefühle übersetzen können, mit der wir gefühlsmäßig
erkennen und interpretieren können. Diese Fähigkeit bedeutet
deshalb eine präformierte Fähigkeit zur Integration, weil
durch sie Erfahrungen integriert werden können (Integration
ist ein Hauptmerkmal von Reifung und Entwicklung). Hieraus kann
sich dann ein einheitliches, "identisches" Bild unserer Selbst,
des Anderen und unserer Umwelt herauskristallisieren. 3. Eine angeborene Strukturierungsfähigkeit Strukturieren und die eigenen Erfahrungen
zuordnen (um damit Welterklärung zu finden) sind ein zentrales
Bestreben bereits der ersten Tage und Wochen. Der Säugling
bedient sich eines einfachen, grundlegenden und nahe liegenden Prinzips:
er sucht nach dem Gleichbleibenden in seinem Erleben vor dem Hintergrund
des variierenden Geschehens (der wechselnden Interaktionspartner,
Handlungen und Orte). Die gleichbleibenden Strukturen, die so genannten
"Invarianten", bilden die erste Ordnungsstruktur. Zu Beginn des
Lebens sind dies die wiederkehrenden und deshalb wiedererkannten
Körperempfindungen, das körperliche Feedback, das alles
Tun und Handeln und Wollen hinterlässt, und die Vitalitätsaffekte,
die Art des Fühlens und Erlebens, das Wie der Gefühle
oder auch der persönliche Stil im Erleben, der zum Stabilsten
im Menschen gehört und sich nach dem 2. Lebensmonat kaum mehr
ändert: Weinen bleibt Weinen, Lachen bleibt Lachen, ob der
Mensch nun 2 Monate oder 90 Jahre alt ist. 4. Das angeborene und starke Beziehungsbedürfnis Der Beziehungswunsch ist der eigentliche
innere (Entwicklungs-)Motor, der den Menschen antreibt, das soziale
Zusammensein und die persönliche Ordnung wiederherzustellen,
und der damit für das persönliche Wachsen und Sich-Entwickeln
verantwortlich ist. Das Ich entsteht am Du (Buber) Die äußere Voraussetzung dafür, dass der innere Dialog überhaupt in Gang kommt, sind zuerst soziale, später auch dingliche, natürliche, virtuelle Interaktionen. Durch sie eröffnen sich äußere Interaktions- und Beziehungsräume, die dem Säugling erlauben, Erfahrungen mit sich selbst und seiner Umwelt zu sammeln. Sind sie emotional ausreichend gehalten, können sie verinnerlicht und damit zu inneren Interaktionsräumen werden. In diesen inneren Räumen können soziale Konstrukte wie das Übergangsobjekt, der evozierte Gefährte, das beseelte Person-Ding etc. entstehen und sich hilfreiche Bilder und einheitliche Welterklärung entwickeln. Äußere Kommunikation stimuliert also die innere Kommunikation. Wachsen bedeutet Begegnung – Begegnung ermöglicht ein Sich-Widerspiegeln im anderen und dadurch (Weiter-)Entwicklung. Der berühmte Dialogiker und Begegnungsphilosoph Martin Buber hat dies schlicht gefasst als: "Das Ich wird am Du" (Buber 1977). Dies geschieht natürlich auch in den Interaktionen mit Kindern, die normalerweise kein Muss sind, sondern natürlich gegeben und motiviert durch das dem Menschen eigene Beziehungsbedürfnis und durch die grundlegende Lebenskraft, die alles Wachsen und Sich-Entwickeln vorantreibt. Die Entstehung innerer Bilder zusammengefasst:
Am Anfang steht die Erfahrung. Erfahrungen hinterlassen eine körperliche
und gefühlsmäßige Erinnerungsspur. Ihre Wiederholung
reaktiviert die erste Erfahrung, die durch die Wiederholung bestärkt
und dann neu gespeichert wird, wodurch sie sich innerlich deutlicher
abbildet. Nach dem Kriterium "bekannt" bzw. "unbekannt" ordnet bereits
der Säugling allmählich und systematisch seine Erfahrungen
und fasst sie zusammen. Schritt für Schritt entstehen auf diese
Weise invariante Konstellationen des Selbst und des Anderen und
werden identifizierbar. Kristallisiert sich eine solche Selbstkonstellation
als Invariante heraus, dann bedeutet dies das Auftauchen von Organisation
– alltagssprachlich würden wir von einem Aha-Erlebnis reden:
aha – so ist das also. Diese Erfahrung des Auftauchens von Organisation
ist das eigentlich kreative Moment und der Urquell aller Subjektivität
und allen schöpferischen und kreativen Erlebens. Es ist die
Grundlage unserer inneren Repräsentationen bzw. unsere innere
Darstellung. Daniel Stern schreibt: "Jegliches Lernen und schöpferische
Tun nimmt seinen Ausgang im Bereich der auftauchenden Bezogenheit.
Nur dieser Erfahrungsbereich hat an der Herausbildung von Organisation
– dem Aha-Erlebnis und sei dies in noch so rudimentärer Form
– teil. Sie bildet den Kern des Schaffens und Lernens. Sie bleibt
ein Leben lang aktuell und wird bei jeder neuen Herausforderung
oder (Entwicklungs-)Aufgabe wieder aktiviert (Stern 1994, S. 103). Innere Bilder als Episoden Eine Erfahrung bildet sich ab und besitzt
nun die Möglichkeit zu ihrer Fortsetzung und Erweiterung durch
Neuverknüpfung. Sehr früh ist der Mensch in der Lage,
sowohl die einzelnen Erfahrungen und Wahrnehmungen zu Invarianten
zusammenzufassen als auch die einzelnen Invarianten zu Erfahrungskonstellationen
zu verbinden, d.h. sie in ein zeitliches, räumliches, kausales
Verhältnis zueinander zu stellen. Auf diese Weise entstehen
zusammen mit den Invarianten die prototypische Erwartungshaltung
an ein Geschehen und die prototypische Interaktionserfahrung in
diesem Geschehen. Als kleine Episoden oder nach Stern als ein "kohärenter
Block gelebter Erfahrung" bzw. "Inseln der Konsistenz" bilden sie
sich im Gedächtnis ab und werden dort repräsentiert. Kleine
Episoden setzen sich aus verschiedenen Attributen oder Teilerfahrungen
zusammen. Als Beispiel dazu könnten wir uns einen Kindergeburtstag
vorstellen mit allem, was dazugehört: mit dem "Happy Birthday",
den Kerzen, dem Kuchen und den Spielen – und oft einem spezifischen,
nicht wegzudenkenden und den Geburtstag erst ausmachenden Geburtstagsritual.
Vergleichbar einem Molekulargeflecht vernetzen sich die Episoden
mehr und mehr zu einer zunehmend differenzierten Erfahrungsmatrix,
einem komplexen Netzwerk organisierter Selbsterfahrung. Die Erfahrungsmatrix
speichert all unsere Erfahrungen, verbindet sie und macht sie für
das Verstehen und für die Welterklärung nutzbar. Sie bildet
die kognitive und gefühlsmäßige Basis für unser
Denken, für unsere subjektive Sicht von Welt mit unserem spezifischen
individuellen Lebensgefühl. Innere Bilder als evozierter Gefährte Die innere Kommunikation ermöglicht den Vernetzungsprozess – dieser innere Dialog beginnt, sobald der Säugling über einen rudimentären Erfahrungsschatz verfügt! Daniel Stern konnte zeigen, dass sich der Mensch ständig und immer auch gleichzeitig sowohl mit den aktuellen Ereignissen und Interaktionen als auch mit seinen erinnerten Interaktionserfahrungen befasst. In einem nicht abreißenden inneren Dialog stellt er Aktuelles und Erinnertes einander gegenüber, vergleicht, evaluiert, passt an und speichert neu – es ist ein blitzschnelles Vergleichen evozierter rekonstruierter Erfahrungen mit Aktuellem. Wie die Episoden, so gehen auch die evozierten Gefährten aus dem inneren Dialog hervor. Sie sind eine psychische Konstruktion, die getragen ist vom Wunsch, das Zusammensein mit einem bedeutungsvollen Anderen wiederzubeleben und aufrecht zu erhalten, d. h. von Lebendigem umgeben zu sein, selbst dann, wenn man (der Säugling) konkret alleine ist. Dabei kann sich schon der Säugling kreativ und schöpferisch erleben. Der evozierte Gefährte ist das innere Bild einer bestimmten Person, in einem bestimmten Interaktionszusammenhang. Auch wenn wir uns den evozierten Gefährten durchaus als Person vorstellen können, ist er mehr als eine Person, eher eine Interaktionssequenz mit spezifischer gefühlsmäßiger Färbung. Viele solcher evozierten Gefährten bevölkern unsere Psyche und werden anhand von Attributen der aktuellen Interaktionssituation auf den Plan gerufen, durch ein Hin- und Heroszillieren verglichen, ausgewertet, angepasst. Dieses blitzschnelle Hin- und Heroszillieren gleicht einem Selbstgespräch, das zunehmend nach innen verlegt wird, das wir aber bei Kindern auch oft noch mithören und ab und zu bei uns selbst beobachten können (Etienne Klemm 1999). Das Besondere an den Episoden und evozierten Gefährten ist, dass sie sowohl zusammen mit den ursprünglichen Gefühlen als auch mit den vergangenen Bewältigungsstrategien evoziert werden. Sie stellen deshalb eine Art Archiv der Vergangenheit dar, erlauben eine Orientierung in der Gegenwart und durch die Möglichkeit des inneren Probehandelns auch das Antizipieren von Zukünftigem. Dies stiftet Sicherheit, bietet Know-how an, ebenso wie Kontinuität und Präsenz der eigenen Geschichte. Jede Erfahrung bleibt noch vor den klaren Vorstellungen oder verbalen Repräsentationen zusammen mit ihren ursprünglichen Gefühlen im Leibgedächtnis gespeichert – und dies wirkt nachhaltig. Die Gefühle werden bei jeder Reaktivierung der Erfahrung ebenfalls hervorgerufen bzw. aktiviert und auf diese Weise erhält sich die affektive, ja fast magische Kraft der inneren Bilder. Die Fähigkeit, evozierte Gefährten zu konstruieren, bedeutet die Fähigkeit, innere Begleiter im Alltag aufzubauen, einen Beziehungsraum aufrecht zu erhalten und sich sozial eingebunden zu fühlen, selbst wenn man real alleine ist. Auch durch das Fernsehen können evozierte Gefährten hervorgerufen werden: Bei einem Gespräch erklärte mir ein Mädchen, kaum wäre sie zu Hause angelangt, würde sie immer sofort den Fernseher einschalten. Auf meine erstaunte Frage bekam ich folgende Erklärung zu hören: Die ganze Familie gehört zu den Vielsehern, etwas relativ Typisches für Südländer. Dies kreiert eine spezielle Familienatmosphäre – der Fernseher begleitet in dieser Familie das Daheimsein und Zusammensein. Durch das Andrehen des Fernsehers reaktiviert das Mädchen diese Situation, lässt den evozierten Gefährten der Familie aufsteigen und fühlt sich gleich besser. Sie ist nicht mehr so alleine, sondern in Gesellschaft der evozierten Familie, fühlt sich aufgehoben und unterhalten. Und das genügt – eigentlich guckt sie gar nicht zu, sondern sie ist mit dabei. Diese innere Kommunikation bzw. die fortgesetzte
Auseinandersetzung zwischen den aktuellen Ereignissen und dem evozierten
Gefährten bedeutet den roten Faden, der sich durch die
ganze Persönlichkeitsentwicklung zieht. Die Sprache erzwingt einen Zwischenraum Mit dem Spracherwerb wird Neues möglich
und unsere Fähigkeit, innere Bilder zu schaffen, vollzieht
einen gewaltigen Entwicklungssprung. Die Sprache erzwingt einen
Zwischenraum. Das Leben kann ab diesem Moment nicht nur erlebt und
erfahren, sondern nun auch erzählt werden. Die eigentliche
Fantasietätigkeit beginnt, das unmittelbare Erleben wird aufgeteilt
in reale Erfahrung und erzählte Erfahrung. Eine Fantasiewelt
– getragen durch Wünsche und Bedürfnisse – wird möglich,
der Realität kann sich ein Wunsch entgegenstellen und sich
zu einem inneren Bild verdichten, z.B. zu einem Wunschbild für
die Zukunft, zu einem persönlichen Lebens-Bild. Der Mensch
wird nun zum Geschichtenerzähler, zum Erzähler seiner
eigenen Geschichte und zum Schöpfer seines Selbstbildes. Wunschbilder
können sich den realen Selbstbildern entgegensetzen und in
Probedialogen und -handlungen ausgekostet werden. Beobachtbar ist
dies zum Beispiel in den Rollenspielen der Kinder beim Nachspielen
von Filmszenen oder beim Beharren auf der Unverwundbarkeit und Unbesiegbarkeit
des Indianer- oder Cowboyhelden. Als Folge davon repräsentieren
die inneren Bilder nun nicht mehr nur die realen, zwischenmenschlichen
Interaktionen. Wünsche und Bedürfnisse können von
nun an die inneren Abbilder umgestalten, sie können sie verändern,
frisieren, kumulieren etc., motiviert durch den Wunsch nach Bedürfnisbefriedigung,
Spannung, Unterhaltung, Heilung, Sinnhaftigkeit, Teilhabe an der
Kultur und an der Gesellschaft. So beginnt mit der eigentlichen
Fantasietätigkeit auch die Fähigkeit zum symbolischen
Spiel, zur Vorstellung über sich selbst, zur exzentrischen
Position und zur Metaebene. Mit den inneren Bildern entwickelt sich
also auch die subjektive Sicht von Selbst und Welt – von unserem
Selbst- und Weltverständnis. Zusammenfassung: Die Entstehung innerer Bilder Der innere Bildergenerator fängt ganz früh an und begleitet uns durch unser ganzes Leben hindurch. Unsere ersten inneren Bilder sind Abbilder unserer Erfahrungen und Interaktionserfahrungen. Sie entstehen permanent als Teil des normalen menschlichen Entwicklungsprozesses und beruhen ebenso auf den Erfahrungen des Säuglings und des Kleinkinds als auch auf den Erfahrungen der späteren Jahre. Innere Bilder entstehen durch unsere Lebenserfahrung, unser Beziehungserleben und Interaktionserfahrung – d.h. durch unsere Erfahrungen im Alltag mit unseren Bezugspersonen und mit allem, was Leben bedeutet. Innere Bilder bedürfen deshalb der sozialen, natürlichen und virtuellen Interaktionen und Anregungen, um gefördert zu werden und um nicht zu verkümmern. Innere Bilder entstehen durch das Zusammenfließen von Innen und Außen. Mit der Sprache kommen Fantasien und die Abwehr dazu und können nun die Abbilder umformen und verändern. Im Laufe der Entwicklung kommen immer mehr neue und kreative eigene innere Bilder dazu – gefärbt durch unsere Anlagen wie Temperament, unsere emotionalen und kognitiven Kapazitäten, Vitalitätsaffekte etc., motiviert durch Bedürfnisse und Wünsche, materialisiert durch Förderung und Anregung und durch eine reichere oder ärmere Gelegenheit zur Interaktion mit der sozialen, natürlichen und virtuellen Umwelt. Bilderprozesse sind eine Ressource, um mit dem Leben fertig zu werden. Sie sind ein potentes Werkzeug der Seele, ein natürlich gegebenes Instrumentarium zur Selbststärkung und Selbsttätigkeit, zur Selbst- und Welterschaffung, zum Erleben von Freude, Sinnhaftigkeit und Kreativität und zum Erfahren und Entwickeln von Identität. Innere Bilder entspringen dem Erfahrungsschatz und der eigenen Geschichte und enthalten deshalb oft eine höchst persönliche Problemlösung und eine wunscherfüllende Lebensperspektive. Und weil sie auch im Erwachsenenalter der primärprozesshaften Logik verpflichtet sind, müssen sie bestehende Widersprüche nicht auflösen, sondern können sie als Entwicklungsstimulus bestehen lassen. Damit komme ich zu unserer Ausgangsfrage:
Können Fernsehbilder "ausbildern"? Welchen Einfluss könnte
das Fernsehen auf die inneren Bilder haben? Das Fernsehen hat nicht die Kraft, die Kinder "auszubildern", weil der innere Bilderprozess schon im Gang ist Ist der Bilderprozess einmal angestoßen und der Mensch in den inneren Dialog mit sich getreten, dann kann ihn eigentlich nichts mehr bremsen. Die Bilder entstehen permanent und brauchen vor allem die Gelegenheit zu Interaktionen, Beziehungs- und Erfahrungsspielräume, um sich aufzufächern. Die "Fernsehkinder" besitzen bereits ein rechtes Repertoire an Interaktionserfahrungen und damit an inneren Bildern. Sie sind normalerweise der gesprochenen Sprache mächtig, können also fantasieren, sich etwas wünschen, probehandeln durch Nachspielen, Probedialoge und Gespräche mit ihren evozierten Gefährten führen, gucken – und je nach Alter – auch lesen etc. Der innere Bilderprozess und der innere Dialog sind in dem Moment bereits im Gang, in welchem die Kinder mit dem Fernsehen beginnen. Das Fernsehen ist jedoch oft ein mächtiger Interaktionspartner, weil viel Zeit vor dem Fernseher verbracht wird, der Fernseher auch in der Familie viel Raum einnimmt, und weil der Konsum von Bildern an keine besonderen Fähigkeiten gebunden ist. So sagte mir ein kleiner Junge auf eine entsprechende Frage: Nein, lesen könne er noch nicht, aber gucken. Über das Bild haben die Kinder Zugang zu allen Lebensbereichen – ob es ihrem Alter und Entwicklungsstand entspricht oder nicht. Der Einstieg ins Leben über vorgefertigte Konservenbilder ist natürlich ein anderer als über eigene, begleitete Erfahrungen, mit denen sich die Kinder die Welt selber aneignen und sie in ihrem Tempo und gemäß ihrem eigenen Entwicklungsprozess erschaffen. Über Fernsehbilder findet unmerklich eine Kolonialisierung des Unbewussten statt. Fernsehwerte prägen oft die Wünsche und Bedürfnisse und das Weltbild. Und überdies können die Fernsehbilder in ihrer ganzen Perfektion die Kraft haben, die eigenen Bilder der Kinder verkümmern und verarmen zu lassen, weil das eigene Schaffen dieser Konkurrenz scheinbar nicht Stand halten kann. Die Fernsehwelt kann sehr dominant und damit ungesund werden, wenn ein Mangel an realen Erfahrungen besteht und/oder wenig ausgleichende reale Interaktionspartner vohanden sind, die immer wieder anregen, neue Ideen selber umzusetzen und auszuprobieren – natürlich geht das über die alleinige Verantwortlichkeit der Fernsehleute hinaus. Für einen guten inneren Bilderfluss jedoch braucht es ein gutes Verhältnis zwischen vorfabrizierten und selbsttätigen, sinnlich anschaulichen Erfahrungsbildern und der Möglichkeit zum Greifen, um zu begreifen. Weil das Fernsehen ein Interaktionspartner ist, bilden sich auch die Fernseh-Interaktionen ab und werden innerlich repräsentiert. Sie begleiten die Kinder als gute und förderliche, weil geglückte, oder aber als schlechte und hinderliche innere Bilder und evozierte Gefährten durch den Alltag. Kinder interessieren sich für das echte Leben und mögen deshalb Sendungen, die an ihre Erfahrungen anknüpfen und in dem Sinne gute Fernsehbilder liefern, dass sie ihnen erlauben, die Grenzen ihrer Alltagserfahrung auszudehnen, sich im Fundus neuer Bilder zu bedienen, sich angesprochen und beteiligt zu fühlen und aus den Geschichten Anregung fürs eigene Leben zu erhalten. Es liegt auf der Hand, dass den Fernsehschaffenden aus diesem Umstand eine große Verantwortung erwächst. Es ist Teil ihrer Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese mächtigen Fernsehbilder gute Interaktionspartner sind, die an die Welt der Kinder anknüpfen und die Unterhaltung bieten sowie neues Wissen, Anregung, Stimulierung, Identifizierung und Entwicklung. Außerdem ist es ihre Aufgabe, Fernsehbilder anzubieten, die nicht traumatisieren – sodass die Bilder in den Köpfen stecken bleiben – und die nicht – vor lauter bedrängender, äußerer Stimulanz – die für alles Kreative notwendigen, inneren Räume erdrücken und einengen. Weil das Fernsehen keine Einzelerfahrung ist, hat es eine lang anhaltende Wirkung und Einwirkung und ist als Interaktionspartner, der innere Bilder und auch evozierte Gefährten schafft und schaffen kann, sehr ernst zu nehmen. Das Fernsehen kann wachstumsförderliche Funktionen übernehmen, wie z.B. die des Erfahrungs-, Bilder- und Geschichtenlieferanten – wie früher die Großmütter und Großväter, später auch das Buch und das Radio. Fernsehgeschichten können eine positive Modellfunktion übernehmen, gerade wenn sie auf eine kluge und humorvolle Weise heikle Themen wie Gewalt und Aggression aufgreifen. Denn das Fernsehen ist ein Interaktionsmodell, bei dem die Kinder vor allem durch Beobachten lernen und sich dabei eigene, innere Modelle erschaffen. Und es bleibt zu hoffen, dass auch rund um das Fernsehen die Sprache einen Zwischenraum erzwingt, d.h. dass viele die Fernsehsendungen beleitende Gespräche stattfinden, dass über das Wort das Einordnen gelingt und Fantasie und Realität sich immer wieder etablieren können. In diesem Sinne abschließend die Meinung
eines 11-jährigen Kindes darüber, was gutes Fernsehen
ausmacht: "Eine gute Sendung muss spannend sein, aber nicht so sehr,
dass man Bauchweh bekommt, sie muss lustig sein, aber nicht so blöd
lustig, sie darf nicht zu brutal sein und sie darf kein offenes
Ende haben, weil man sich sonst das Schlimmste vorstellt."
Buber, Martin: Ich und Du. Heidelberg: Lambert Schneider 1977. Eisler, Rudolf: Kant-Lexikon. Nachschlagewerk zu Kants sämtlichen Schriften, Briefen und handschriftlichem Nachlass. Hildesheim/Zürich: Georg Olms 1994. Etienne Klemm, Ruth: Innere Bilder – Entstehung und Ausdruck von Ein-Bildungen und ihr therapeutisches Potential. Zürich: Universitätsdruck 1999. Kohnstamm, Rita: Praktische Psychologie des Schulkindes. Bern: Huber 1996 (3. Aufl.) Salvisberg, Hans: Von der amodalen Wahrnehmung zur Katathymen Imagination. Gedanken zur Progression des Primärprozesses. In: Kottje-Birnbacher, Leonore u.a.: Imagination in der Psychotherapie. Bern: Huber 1997. Sartre, Jean Paul: Das Imaginäre (1940). Reinbek b. Hamburg: Rowohlt 1980. Stern, Daniel: Die Lebenserfahrung des Säuglings. Stuttgart: Klett 1994 (4. Aufl.) Winnicott, Donald W.: Vom
Spiel zur Kreativität. Stuttgart: Klett 1973.
Ruth Etienne Klemm, Dr. phil, arbeitet als Psychologin und Psychotherapeutin in Zürich in der Schweiz.
Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen IZI Tel.: 089 - 59 00 29 91 Fax.: 089 - 59 00 23 79 eMail: izi@brnet.de internet: www.izi.de
Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers!  zum Seitenanfang zum Seitenanfang
|
|||||||||||||||||
| Das IZI
ist eine Einrichtung des Bayerischen
Rundfunks |
