|
Birgit van Eimeren
Mediennutzung und Fernsehpräferenzen
der 10- bis 15-Jährigen
Nach wie vor sind Fernsehen und Hörfunk
die am meisten genutzten Jugendmedien. Unterhaltungsshows, Spielfilme
und Daily Soaps sehen die Jugendlichen am liebsten - Nachrichten kaum.
1. Einleitung
In dem am 29.10.2000 ausgestrahlten BR-"Tatort"
ermittelten die Kommissare Batic und Leitmeir hinter den Kulissen der
(fiktiven) Daily Soap "Total das Leben". Konfrontiert mit der Hektik
des täglichen Produktionsprozesses, den Allüren der Soap-Stars
und den für die Kommissare äußerst befremdlichen Reaktionen
der meist jungen, weiblichen Fans antwortet ein Fan auf die Frage "Was
ist dran an dieser Serie?":
"Ja, für mich ist das eine liebgewonnene
Gewohnheit. Wenn ich nach Hause komme dusche ich, nehm mir ein Bier,
und um fünf vor halb acht sitze ich vorm Fernseher. ‚Total das
Leben‘ gehört einfach dazu, verstehen Sie? ....Mit der Zeit kommen
einem die Personen in der Serie immer näher, so wie Freunde,
Bekannte, Nachbarn. Man will einfach wissen, was mit ihnen passiert.
Ersatz für Tratsch im Treppenhaus... ...Dass die Serie nicht
besonders anspruchsvoll ist, weiß ich auch. Es ist wie eine
Droge. Ich bin süchtig."
Daily Soaps arbeiten fast alle mit ähnlichen
Stilmitteln: Das Alltägliche, Banale wird in stark emotionalisierter,
übersteigerter Form in Szene gesetzt, parallel zur Überdramatisierung
das Ungewöhnliche, Bedrohliche entdramatisiert und als alltäglich
dargestellt. Da sich die Soaps im Gegensatz zum US-amerikanischen Fernsehmarkt
in Deutschland überwiegend an ein junges Publikum wenden, werden
bevorzugt Themen aufgegriffen, die Jugendliche beschäftigen: Beziehungen,
Sexualität, Mode, Trends, Berufsein- und -aufstieg. Damit bedienen
die Daily Soaps – ähnlich wie die täglich ausgestrahlten Talkshows
– das Bedürfnis nach Identifikationsflächen und Rollenmustern,
und nicht zuletzt nach Voyeurismus.
Unbestritten ist, dass die Bedeutung der Medien
für die Sozialisation von Kindern und Jugendlichen in den letzten
Jahrzehnten massiv angestiegen ist. Eine nicht medial beeinflusste Kindheit
und Jugend ist nicht vorstellbar. Medien, und hier vor allem das Fernsehen,
prägen Alltagserleben, vermitteln Handlungsmuster und Normen und
helfen, sich mit der Welt der Erwachsenen auseinander zu setzen. In
einer Zeit, in der klassische Familienstrukturen immer seltener auftreten
und traditionelle Institutionen wie Kirche und Schule an Gewicht verloren
haben, machen Kinder vermehrt ihre Erfahrungen außerhalb des häuslichen
Umfelds. Hier spielt das Fernsehen als zentrales Leitmedium – nicht
nur für Kinder und Jugendliche – eine besondere Rolle. Das Fernsehen
kann Vorbild für individuelle Wertorientierung, für Kommunikations-
und Verhaltensmuster sein. Fernsehen gehört zum Alltag von Kindern
und Jugendlichen. Ein Ausschluss von Fernsehen bedeutet auch, Kinder
und Jugendliche von einem Teil ihrer Lebenswelt auszuschließen.
Wie gehen Heranwachsende überhaupt mit Medien um? Welchen Anteil
nehmen die einzelnen Medien im Zeitbudget der Kinder und Jugendlichen
ein? Und haben der Computer und das Internet – wie es manche Autoren
vermitteln – das Fernsehen in seiner Bedeutung abgelöst?
Definition: Kinder - Jugendliche - Erwachsene
Bevor wir uns den quantitativen Daten der Medienforschung
zum Medienverhalten der Jugendlichen zuwenden, ist eine definitorische
Abgrenzung der "Jugendlichen" von den "Kindern" und den "Erwachsenen"
notwendig. Die Definition von Jugend wird zunehmend schwieriger. Der
sogenannte Reifungsprozess beginnt immer früher. Gleichzeitig dauert
die Jugend aufgrund längerer Ausbildungszeiten sowie eines Bedeutungsverlustes
traditionell wichtiger Statuspassagen wie Heirat oder Gründung
eines eigenen Hausstandes immer länger. Aber nicht nur externe
Ursachen führen zu einer Verschiebung der Generationsgrenzen. Der
Jugendkult unserer Gesellschaft führt bei vielen Zeitgenossen zu
einer erheblichen Distanz zwischen kalendarischem und wahrgenommenem
Alter, was den "tatsächlichen" Jugendlichen die für ihre Identitätsfindung
wichtige Abgrenzung von der Welt der Erwachsenen erschwert. Wissenschaftliche
Arbeiten im Bereich der Jugendforschung sind dementsprechend nicht einheitlich
in der Wahl der Altersbegrenzung. 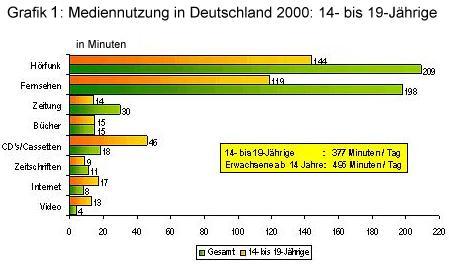 So wählt beispielsweise die "Shell-Studie" eine relativ breite
Definition (15 bis 24 Jahre) für die Untersuchung "Jugend 2000".
Entwicklungspsychologisch betrachtet wäre hier die Bezeichnung
"Junge Erwachsene 2000" vielleicht treffender. In einer anderen, vom
Jugendministerium in Auftrag gegebenen Studie wurde die obere Altersgrenze
gar erst bei den 30-Jährigen festgesetzt. Im Bereich der praxisorientierten
Forschung, z.B. der Medienforschung, gilt die Konvention, junge Menschen
ab 14 Jahren als Erwachsene zu etikettieren. Entsprechend beginnen die
Datenerhebungen in den wichtigsten Standard-Untersuchungen wie der "Media
Analyse" oder der "Massenkommunikation" erst bei den Ab-14-Jährigen.
Langfristige Vergleiche für die Medienentwicklung speziell bei
"Jugendlichen" erfolgen – dieser Konvention zufolge – generell für
die Altersgruppe der jeweils 14- bis 19-Jährigen.
So wählt beispielsweise die "Shell-Studie" eine relativ breite
Definition (15 bis 24 Jahre) für die Untersuchung "Jugend 2000".
Entwicklungspsychologisch betrachtet wäre hier die Bezeichnung
"Junge Erwachsene 2000" vielleicht treffender. In einer anderen, vom
Jugendministerium in Auftrag gegebenen Studie wurde die obere Altersgrenze
gar erst bei den 30-Jährigen festgesetzt. Im Bereich der praxisorientierten
Forschung, z.B. der Medienforschung, gilt die Konvention, junge Menschen
ab 14 Jahren als Erwachsene zu etikettieren. Entsprechend beginnen die
Datenerhebungen in den wichtigsten Standard-Untersuchungen wie der "Media
Analyse" oder der "Massenkommunikation" erst bei den Ab-14-Jährigen.
Langfristige Vergleiche für die Medienentwicklung speziell bei
"Jugendlichen" erfolgen – dieser Konvention zufolge – generell für
die Altersgruppe der jeweils 14- bis 19-Jährigen.
Eine sicherlich der heutigen Zeit angemessenere Definition von Jugendlichen
ist der Bezug auf die 10- bis 15-Jährigen und die 16- bis 19-Jährigen.
Leider liegen jedoch aufgrund der oben beschriebenen Konventionen, mit
Ausnahme des Bereiches Fernsehen, kaum Daten für diese beiden Zielgruppen
vor. Daher werden sich Exkurse auf die Mediennutzung von "Jugendlichen"
mit Ausnahme der Fernsehnutzung auf die Gruppe der 14- bis 19-Jährigen
beziehen müssen.
2. Medienkonsum der 14- bis
19-Jährigen
| 377 Minuten,
also mehr als 6 Stunden, verbringt ein 14- bis 19-jähriger
Jugendlicher täglich mit Medien (s. Grafik 1). Der Löwenanteil
entfällt auf die "alten" Massenmedien Fernsehen und Hörfunk.
Nur ein relativ geringer Teil, nämlich im Durchschnitt 17 Minuten
täglich, kommt der Beschäftigung mit dem Internet zugute.
Auch die Nutzung audiovisueller Speichermedien wie CDs hören
oder Videofilme ansehen nimmt mit 46 Minuten täglich bzw. 13
Minuten täglich – gemessen an der Dominanz von Fernsehen und
Hörfunk – nur einen relativ kleinen Teil des Medienbudgets
in Anspruch.
|
|
Tabelle 1: Anteil der Internet-Nutzer
nach Altersgruppen (in %)
| |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
| Gesamt |
6,5 |
10,4 |
17,7 |
28,6 |
| 14-
bis 19-Jährige |
6,3 |
15,6 |
30,0 |
48,5 |
| 20-
bis 29-Jährige |
13,2 |
20,7 |
33,0 |
54,6 |
| 30-
bis 39-Jährige |
12,4 |
18,9 |
24,5 |
41,1 |
| 40-
bis 49-Jährige |
7,7 |
11,1 |
19,6 |
32,2 |
| 50-
bis 59-Jährige |
3,0 |
4,4 |
15,1 |
22,1 |
| 60-Jährige
und älter |
0,2 |
0,8 |
1,9 |
4,4 |
Quelle: ARD-/ZDF-Online-Studie
2000
|
In der Gewichtung der Medien im Medienalltag
sind die Unterschiede zwischen Jugendlichen und der Gesamtheit der Mediennutzer
nicht so groß, wie es manche Autoren zu vermitteln scheinen. Die
klassischen elektronischen Medien Fernsehen und Hörfunk bleiben
auch bei Jugendlichen die den Alltag dominierenden Medien. Sie nehmen
rund 70% des täglichen Medienbudgets ein, bei allen Mediennutzern
liegt der Anteil von Fernsehen und Radio bei 82%. Die Möglichkeit,
der "eigene Programmdirektor" zu sein, wird zwar von den Jugendlichen
– sei es über das Internet (s. Tabelle 1), sei es über CDs
und Videokassetten – stärker ausgeschöpft. Wie in allen anderen
Altersgruppen überwiegt jedoch auch bei den Jugendlichen die passive
und eher konsumierende Mediennutzung eindeutig vor der aktiven und selbstbestimmten.
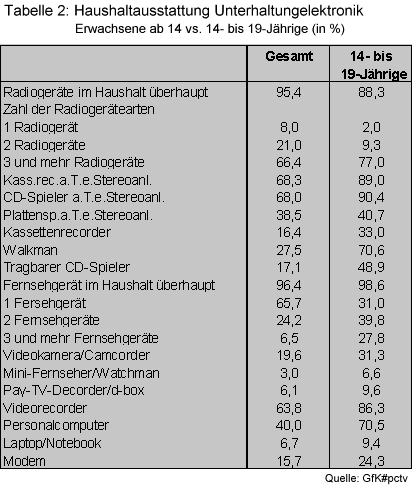 Begünstigt wird die Mediennutzung naturgemäß durch die
Ausstattung mit elektronischer Hardware in den Haushalten, in denen
Jugendliche leben (s. Tabelle 2). Gemessen an der Geräteverbreitung
im bundesdeutschen Durchschnitt sind Haushalte mit Jugendlichen häufiger
mit medialer Hardware ausgestattet:
Begünstigt wird die Mediennutzung naturgemäß durch die
Ausstattung mit elektronischer Hardware in den Haushalten, in denen
Jugendliche leben (s. Tabelle 2). Gemessen an der Geräteverbreitung
im bundesdeutschen Durchschnitt sind Haushalte mit Jugendlichen häufiger
mit medialer Hardware ausgestattet:
In nahezu jedem Haushalt mit Jugendlichen sind zumindest ein Fernsehgerät,
eine Stereoanlage und ein Videorecorder vorhanden. Mehr als 70% der
Haushalte mit Jugendlichen verfügen über einen PC oder Laptop
– bezogen auf die Gesamtheit aller Haushalte trifft dies nur auf 40%
zu.
3. Fernsehnutzung der 10- bis
15-Jährigen
3.1 Überblick
Bei den 10- bis 15-Jährigen zeigt sich die Dominanz des Mediums
Fernsehen ebenso wie bei allen anderen potenziell zu betrachtenden Zielgruppen.
Im ersten Halbjahr 2000 verbrachte jeder 10- bis 15-Jährige in Deutschland
täglich 118 Minuten vor dem Fernseher (s. Tabelle 3). Dabei hat sich
am Fernsehkonsum der Jugendlichen in den letzten 5 Jahren wenig geändert.
1995 war ein Durchschnittswert für diese Altersgruppe von 117 Minuten
zu verzeichnen. Lediglich 1992, dem Jahr, in dem erstmalig Daten für
West- und Ostdeutschland zur Verfügung stehen, betrug die tägliche
Sehdauer der 10- bis 15-Jährigen 109 Minuten.
Tabelle 3:
Entwicklung der täglichen Sehdauer der 10- bis 15-Jährigen
in Deutschland, 1988 – 1. Halbjahr 2000 (in Minuten)
| |
1988 |
1992 |
1995 |
1999 |
01-06/2000 |
| Gesamt |
n.v.* |
109 |
117 |
118 |
118 |
| Westdeutschland |
100 |
100 |
114 |
112 |
110 |
| Ostdeutschland |
n.v.* |
138 |
125 |
134 |
139 |
| 10- bis 11-Jährige |
n.v.* |
104 |
112 |
102 |
102 |
| 12- bis 13-Jährige |
n.v.* |
117 |
115 |
126 |
117 |
| 14- bis 15-Jährige |
n.v.* |
108 |
124 |
128 |
133 |
| Mädchen |
n.v.* |
109 |
113 |
114 |
119 |
| Jungen |
n.v.* |
110 |
121 |
122 |
117 |
| *Daten nicht
verfügbar |
Analysiert man den Fernsehkonsum der westdeutschen
10- bis 15-Jährigen, so ist auch in der Langzeitbetrachtung kein
dramatischer 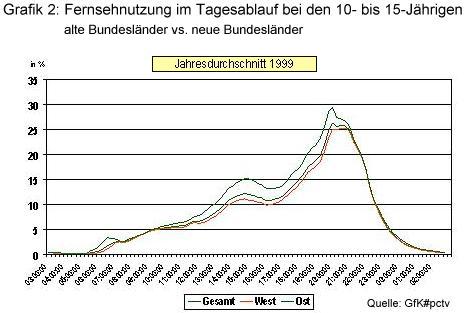 Anstieg der Fernsehnutzung aufzuzeigen (s. Grafiken 2,3 und 4). 1988,
d.h. noch in der Aufbauphase des Dualen Systems in Deutschland, wandten
sich westdeutsche 10- bis 15-Jährige täglich 100 Minuten dem
Fernsehen zu. Im ersten Halbjahr 2000 sind unter den westdeutschen Jugendlichen
110 Minuten zu verbuchen.
Anstieg der Fernsehnutzung aufzuzeigen (s. Grafiken 2,3 und 4). 1988,
d.h. noch in der Aufbauphase des Dualen Systems in Deutschland, wandten
sich westdeutsche 10- bis 15-Jährige täglich 100 Minuten dem
Fernsehen zu. Im ersten Halbjahr 2000 sind unter den westdeutschen Jugendlichen
110 Minuten zu verbuchen.
Einen höheren Stellenwert im Alltag nimmt das Fernsehen bei den
10- bis 15-Jährigen in den neuen Bundesländern ein. Mit 139
Minuten widmen sie sich rund eine halbe Stunde länger den Fernsehangeboten
als ihre westdeutschen Altersgenossen. Dabei handelt es sich keineswegs
um ein Phänomen, das lediglich bei den jüngeren Zuschauern
anzutreffen ist. Auch 10 Jahre nach dem Mauerfall ist für die Gesamtheit
aller bundesdeutschen Zuschauer keine Angleichung zwischen den Fernsehgewohnheiten
und den Programmvorlieben in den neuen und alten Bundesländern
festzustellen. Ostdeutsche schauen deutlich länger 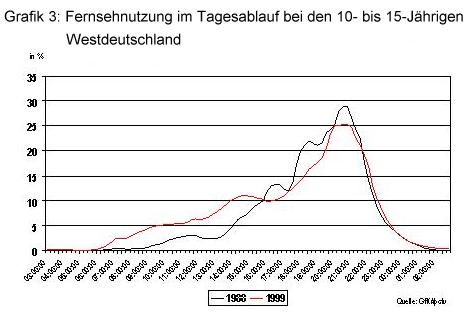 fern als Westdeutsche. Diese Diskrepanz zieht sich durch alle Altersgruppen.
Da sie sich bei den jüngsten und jüngeren Zuschauern eher
verstärkt als nivelliert, ist mit einer Angleichung der Sehgewohnheiten
in den nächsten Jahren kaum zu rechnen.
fern als Westdeutsche. Diese Diskrepanz zieht sich durch alle Altersgruppen.
Da sie sich bei den jüngsten und jüngeren Zuschauern eher
verstärkt als nivelliert, ist mit einer Angleichung der Sehgewohnheiten
in den nächsten Jahren kaum zu rechnen.
Parallel zur Gesamtheit aller Zuschauer liegt die Hauptfernsehzeit der
10- bis 15-Jährigen zwischen 18 Uhr und 22 Uhr. Bei den 10- bis
13-Jährigen liegt der "Reichweiten-Peak" etwas früher als
bei den 14- bis 15-Jährigen. Die Hauptfernsehzeit in allen Altersgruppen
liegt bei der "20 Uhr-Marke": Rund ein Viertel aller Jugendlichen versammelt
sich zu diesem Zeitpunkt täglich vor dem Bildschirm.
3.2 Beliebteste Fernsehgenres und Sendungen Entsprechend
der zeitlichen Verteilung der Fernsehnutzung handelt es sich bei den
meistgesehenen Sendungen nahezu ausschließlich um Sendungen, die
ab 19.30 Uhr ausgestrahlt werden. In den Top 50 der meistgesehenen Sendungen
der 10- bis 15-Jährigen im 1. Halbjahr 2000 rangieren ganz oben
Unterhaltungsshows ("Wetten dass...?", "Wer wird Millionär?"),
Spielfilme ("Der verrückte Professor") und besonders prominent
vertreten die Daily Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" von RTL. Innerhalb
der Top 50 ist "GZSZ" allein 30 Mal vertreten.
Die RTL-Serie kommt besonders gut bei den 10- bis 15-jährigen Mädchen
an. Nicht nur erzielte die Soap 1999 einen durchschnittlichen Marktanteil
bei den jüngeren Zuschauerinnen von 56,6% - bei den Jungen waren
es "nur" 34,1%. Gleichzeitig ist die Top 50 der Mädchen aus dem
1. Halbjahr 2000 fast ausschließlich durch Folgen von "Gute Zeiten,
schlechte Zeiten" belegt. Lediglich vier der 50 meistgesehenen Sendungen
waren keine Serienfolgen.
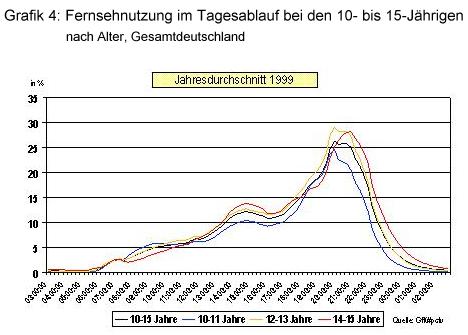 Dagegen taucht "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in der Hitliste der Jungen
zwischen 10 und 15 Jahren nicht einmal auf. Ihre Top 50 deckt ein wesentlich
breiteres Angebotsspektrum ab – von Sport-Live-Übertragungen über
Unterhaltungsshows bis hin zu Spielfilmen. Auffallend ist bei ihnen
die hohe Akzeptanz der Trickserie aus der "Pokémon-Welt". Vor
allem bei den 10- bis 15-jährigen Jungen in Ostdeutschland hat
sich die in RTL II ausgestrahlte Trickserie "Pokémon" inzwischen
zu einem der beliebtesten Regelangebote entwickelt.
Dagegen taucht "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in der Hitliste der Jungen
zwischen 10 und 15 Jahren nicht einmal auf. Ihre Top 50 deckt ein wesentlich
breiteres Angebotsspektrum ab – von Sport-Live-Übertragungen über
Unterhaltungsshows bis hin zu Spielfilmen. Auffallend ist bei ihnen
die hohe Akzeptanz der Trickserie aus der "Pokémon-Welt". Vor
allem bei den 10- bis 15-jährigen Jungen in Ostdeutschland hat
sich die in RTL II ausgestrahlte Trickserie "Pokémon" inzwischen
zu einem der beliebtesten Regelangebote entwickelt.
Einen systematischeren Zugang als über die Hitlisten, die eher
eine Aufstellung von besonders attraktiven Einzelereignissen bieten,
liefert die Analyse nach der Akzeptanz von einzelnen Programmsparten
(s. Tabelle 7). Nicht überraschend zeigt sich generell: die Fernsehvorlieben
der 10- bis 15-Jährigen unterscheiden sich deutlich von den Vorlieben
der Gesamtheit der Zuschauer. Sparten, die in den Vollprogrammen gemeinhin
als Quotengaranten gelten, treffen bei den 10- bis 15-Jährigen
auf nur wenig Interesse. In diesem Zusammenhang sind an erster Stelle
Nachrichten und Wetterinformationen zu nennen. Die im ersten Halbjahr
2000 in den AGF*-Sendern ausgestrahlten 50.098 Nachrichtensendungen
erzielten einen durchschnittlichen Marktanteil von 3,9% bei allen bundesdeutschen
Zuschauern, bei den 10- bis 15-Jährigen lag die Marktausschöpfung
lediglich bei 1,4%. Eine ähnliche Relation zeigt sich bei den im
allgemeinen im Anschluss an die Nachrichten ausgestrahlten Wetterinformationen:
5,3% Marktanteil in der Gesamtheit aller Zuschauer stehen 2,2% Marktanteil
bei den 10- bis 15-Jährigen gegenüber.
Tabelle 7: Marktanteil nach Programmsparten,
1. Halbjahr 2000 (in %)
| Programmsparte |
10-
bis 15-
Jährige |
Zuschauer
ab
3 Jahre |
| Zeichentrickserie |
14,4 |
4,2 |
|
Serie
|
7,7 |
5,4 |
| Spielfilm |
6,1 |
4,9 |
| Fernsehfilm |
4,7 |
6,1 |
| Unterhaltungsshow |
3,5 |
5,3 |
| Talkshow |
3,2 |
4,8 |
| Wetterinformationen |
2,2 |
5,3 |
| Musiksendungen |
1,8 |
1,5 |
| Reportagen/Dokumentationen/Magazine |
1,6 |
2,6 |
| Nachrichten |
1,4 |
3,9 |
Von Reportagen bis zu Nachrichten
Auch Reportagen, Dokumentationen und Magazine mit mehr oder minder informativem
Charakter finden nur selten das Interesse der Jugendlichen. Das relativ
geringe Interesse Jugendlicher an (tagesaktuellen) INFORMATIONsendungen
bestätigt eine Vielzahl von Studien, die zu dem Thema Jugend und
Medien durchgeführt wurde. So konnte beispielsweise die vom Bayerischen
Rundfunk und vom Internationalen Zentralinstitut für das Jugend-
und Bildungsfernsehen 1997 durchgeführte Untersuchung nachweisen,
dass sich Jugendliche von den klassischen Nachrichten- und Magazinformen
nicht angesprochen fühlen. Sie sind häufig zu sach-, weniger
personenorientiert, zu abstrakt statt konkret und personalisiert, und
oft eher unter einem gesamt-gesellschaftlichen als unter einem alltagsbezogen-individualistischen
Blickwinkel aufbereitet. Gerade diese formal-inhaltlichen Kriterien
bedingen, dass INFORMATIONsendungen vielen Jugendlichen als "langweilig"
und an ihren Interessen vorbeiproduziert erscheinen. Personalisierung
und Nachvollziehbarkeit scheinen auch ein Schlüssel zum Erfolg
von Magazinen wie "Explosiv – Das Magazin" (RTL) zu sein, die diese
Elemente in ihren Beiträgen gezielt einsetzen. Nicht umsonst zählt
"Explosiv" seit Jahren zu den beliebtesten INFORMATIONsendungen der
bundesdeutschen Jugendlichen.
Zudem werden Nachrichten häufig im Rahmen des bereits eingeschalteten
Programms "mitgenommen". So konnten sich die "RTL2-News", die täglich
um 20.00 Uhr ausgestrahlt werden, während der ersten "Big Brother"-Staffel
(Beginn: 20.15 Uhr) zu einer der bei Jugendlichen erfolgreichsten Nachrichtensendung
entwickeln.
Daily Soaps
Die größten Unterschiede zwischen den Genrevorlieben
der 10- bis 15-Jährigen und der Gesamtheit der Zuschauer zeichnen
sich bei dem Genre Zeichentrickserie ab: Während Zeichentrick-Serien
im Schnitt 14,4% der fernsehenden 10- bis 15-Jährigen erreichen,
liegt der Marktanteil dieser Programmsparte bei allen Zuschauern nur
bei 4,2%. Auf überdurchschnittliche Akzeptanz bei den Jugendlichen
stoßen auch die Serien, insbesondere die Daily Soaps. Im ersten
Halbjahr 2000 wurden in den AGF-Sendern insgesamt 65.064 Serienfolgen
ausgestrahlt, die bei den 10- bis 15-Jährigen einen durchschnittlichen
Marktanteil von 7,7% erzielten (Zuschauer gesamt: 5,4%).
Geschlechtsspezifische Unterschiede sind nicht auszumachen, ebenso wenig
zeigen sich Differenzen in der Serienakzeptanz zwischen den Jugendlichen
in den neuen und alten Bundesländern. Lediglich bei den 10- bis
11-Jährigen stoßen die Serien mit durchschnittlich 8,3% Marktanteil
auf eine leicht überdurchschnittliche Akzeptanz.
Besonders erfolgreich unter den Serienproduktionen sind die
Daily Soaps. "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (RTL) "Verbotene Liebe"
(ARD) und "Marienhof" (ARD) erzielen Marktanteile von 20% und mehr.
Die erfolgreichste unter ihnen ist "Gute Zeiten, schlechte Zeiten",
die täglich um 19.45 Uhr in RTL ausgestrahlt wird. 45,4% aller
zur Sendezeit vor dem Bildschirm versammelten 10- bis 15-Jährigen
schalteten 1999 jede Serienausstrahlung ein. "Verbotene Liebe" erzielte
im Jahre 1999 einen durchschnittlichen Marktanteil von 21,2%, "Marienhof"
von 22,2%.
Der Erfolg aller drei Daily Soaps resultiert maßgeblich aus der
hohen Akzeptanz bei den Mädchen. Zu "GZSZ" schaltet jedes zweite
zur Sendezeit fernsehende Mädchen ein, bei "Verbotene Liebe" und
"Marienhof" ist es knapp ein Drittel aller vor dem Bildschirm versammelten
Zuschauerinnen zwischen 10 und 15 Jahren (s. Tabelle 8).
Tabelle 8: Marktanteil ausgewählter Daily
Soaps bei den 10- bis 15-Jährigen (in %, Æ
1999)
| |
10- bis
15-Jährige gesamt |
10- bis
15-jährige Jungen |
10- bis
15-jährige Mädchen |
"Gute Zeiten, schlechte
Zeiten"
(RTL, 19.45 Uhr) |
45,4 |
34,1 |
56,6 |
"Verbotene Liebe"
(ARD, 18.00 Uhr) |
21,2 |
10,6 |
31,2 |
"Marienhof"
(ARD, 18.30 Uhr) |
22,2 |
12,1 |
32,1 |
Einen außergewöhnlichen Erfolg bei
den 10- bis 15-Jährigen, insbesondere bei den jungen Mädchen,
erzielte auch die erste Staffel von "Big Brother", deren einzelne "Folgen"
von dem Privatsender RTL II zwischen 1. März und 8. Juni 2000 täglich
ausgestrahlt wurden (s. Tabelle 9). "Big Brother" ist keiner der bisher
verwandten Programmkategorien zuordenbar, weshalb Mikos für dieses
neue Genre den Begriff "Hybrid-Genre" definierte: Durch die Vorspiegelung
des "wahren Lebens" und die Ausstrahlung von täglichen Gesprächsrunden
werden Grundzüge der Dokumentation und der Talkshows eingebaut.
Hinsichtlich des täglichen Ausstrahlungsrhythmus, der Konstanz
der Akteure und des Fortsetzungscharakters bedient sich "Big Brother"
eindeutig der Kernelemente der Daily Soaps, so dass auch die Wirkungsweisen
ähnlich sein dürften wie bei den Soaps.
Tabelle 9: Marktanteil von "Big Brother" (1.
Staffel) bei den 10- bis 15-Jährigen(in %, Æ
1.03. – 8.06.2000)
| |
10-
bis 15-Jährige gesamt |
10-
bis 15-jährige Jungen |
10-
bis 15-jährige Mädchen |
"Big Brother"
(RTL 2, 20.15 Uhr) |
25,7 |
28,3 |
23,1 |
Zu den Erklärungsansätzen für
den Erfolg dieser Formate bei den Jugendlichen zählt, dass sie
– ähnlich wie bei dem Phänomen der "Boy Groups" – Charaktere
aufweisen, die sozialen Prototypen bis hin zu Antitypen entsprechen.
Die in den Daily Soaps gezeigten Charaktere und Lebenswelten können
dabei eine verstärkende Funktion für die altersspezifischen
Identitätsprozesse von Jugendlichen haben. Sie bieten Projektionsflächen
und Rollenmuster, um sich im eigene Alltag zurechtzufinden. Indem sie
Inhalte thematisieren, die die Bedürfnisse Heranwachsender gezielt
ansprechen, sind sie Vorbild für die eigene Rollenfindung in der
Welt der Erwachsenen und auch Modell für Mode, Kleidungsstile und
Verhalten gegenüber dem anderen Geschlecht.. Neben diesen psychologischen
Aspekten der Wirkung von Soaps bedienen sie eine Hauptfunktion des Fernsehens:
die Möglichkeit des Eskapismus.
Durch ihren täglichen Ausstrahlungsrhythmus werden die Daily Soaps
von den Rezipienten in ihren Alltag integriert und - ähnlich wie
die 20.00 Uhr-"Tagesschau" bei den Erwachsenen – ritualisiert und habitualisiert
eingeschaltet.
Zweifelsohne kommen diese Daily Soaps den Bedürfnissen und Interessen
der Jugendlichen entgegen. Die Frage, welche Wirkungen die Inhalte der
Serien, die selten etwas mit der tatsächlichen Realität von
Jugendlichen zu tun haben, auf die Rezipienten haben, steht bei vielen
Programmveranstaltern, die Jugendliche eher in ihrer Bedeutung als kommerzielle
Zielgruppe bemessen, hinten an. Denkbar sind sowohl negative Auswirkungen,
wie z.B. die Orientierung an (überschlanken) Schönheitsidealen
bei weiblichen Teenagern, als auch positive Effekte wie die konstruktive
Auseinandersetzung mit der Welt der Erwachsenen.
DIE AUTORIN
Birgit van Eimeren, Dipl.-Psych., ist Leiterin
der Abteilung Medienforschung des Bayerischen Rundfunks, München.
INFORMATIONEN
Internationales
Zentralinstitut
für das Jugend-
und Bildungsfernsehen
IZI
Tel.: 089 - 59 00 21 40
Fax.: 089 - 59 00 23 79
eMail: izi@brnet.de
internet: www.izi.de
COPYRIGHT
© Internationales Zentralinstitut für
das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) 2000
Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit
ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers!
|

 zum Seitenanfang
zum Seitenanfang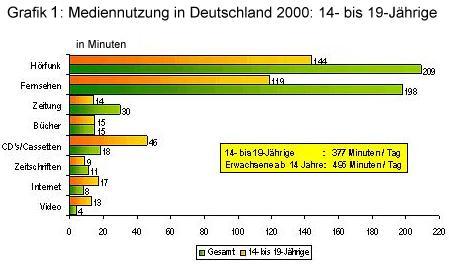 So wählt beispielsweise die "Shell-Studie" eine relativ breite
Definition (15 bis 24 Jahre) für die Untersuchung "Jugend 2000".
Entwicklungspsychologisch betrachtet wäre hier die Bezeichnung
"Junge Erwachsene 2000" vielleicht treffender. In einer anderen, vom
Jugendministerium in Auftrag gegebenen Studie wurde die obere Altersgrenze
gar erst bei den 30-Jährigen festgesetzt. Im Bereich der praxisorientierten
Forschung, z.B. der Medienforschung, gilt die Konvention, junge Menschen
ab 14 Jahren als Erwachsene zu etikettieren. Entsprechend beginnen die
Datenerhebungen in den wichtigsten Standard-Untersuchungen wie der "Media
Analyse" oder der "Massenkommunikation" erst bei den Ab-14-Jährigen.
Langfristige Vergleiche für die Medienentwicklung speziell bei
"Jugendlichen" erfolgen – dieser Konvention zufolge – generell für
die Altersgruppe der jeweils 14- bis 19-Jährigen.
So wählt beispielsweise die "Shell-Studie" eine relativ breite
Definition (15 bis 24 Jahre) für die Untersuchung "Jugend 2000".
Entwicklungspsychologisch betrachtet wäre hier die Bezeichnung
"Junge Erwachsene 2000" vielleicht treffender. In einer anderen, vom
Jugendministerium in Auftrag gegebenen Studie wurde die obere Altersgrenze
gar erst bei den 30-Jährigen festgesetzt. Im Bereich der praxisorientierten
Forschung, z.B. der Medienforschung, gilt die Konvention, junge Menschen
ab 14 Jahren als Erwachsene zu etikettieren. Entsprechend beginnen die
Datenerhebungen in den wichtigsten Standard-Untersuchungen wie der "Media
Analyse" oder der "Massenkommunikation" erst bei den Ab-14-Jährigen.
Langfristige Vergleiche für die Medienentwicklung speziell bei
"Jugendlichen" erfolgen – dieser Konvention zufolge – generell für
die Altersgruppe der jeweils 14- bis 19-Jährigen.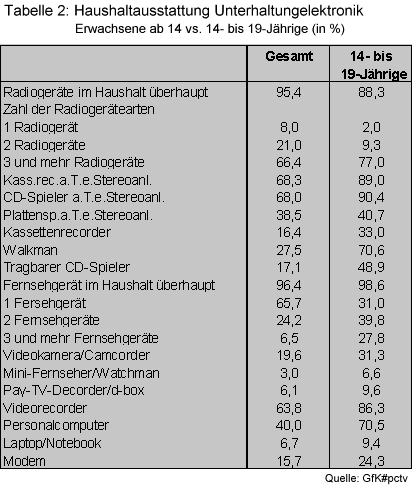 Begünstigt wird die Mediennutzung naturgemäß durch die
Ausstattung mit elektronischer Hardware in den Haushalten, in denen
Jugendliche leben (s. Tabelle 2). Gemessen an der Geräteverbreitung
im bundesdeutschen Durchschnitt sind Haushalte mit Jugendlichen häufiger
mit medialer Hardware ausgestattet:
Begünstigt wird die Mediennutzung naturgemäß durch die
Ausstattung mit elektronischer Hardware in den Haushalten, in denen
Jugendliche leben (s. Tabelle 2). Gemessen an der Geräteverbreitung
im bundesdeutschen Durchschnitt sind Haushalte mit Jugendlichen häufiger
mit medialer Hardware ausgestattet: 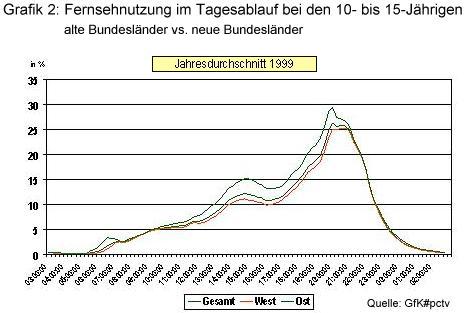 Anstieg der Fernsehnutzung aufzuzeigen (s. Grafiken 2,3 und 4). 1988,
d.h. noch in der Aufbauphase des Dualen Systems in Deutschland, wandten
sich westdeutsche 10- bis 15-Jährige täglich 100 Minuten dem
Fernsehen zu. Im ersten Halbjahr 2000 sind unter den westdeutschen Jugendlichen
110 Minuten zu verbuchen.
Anstieg der Fernsehnutzung aufzuzeigen (s. Grafiken 2,3 und 4). 1988,
d.h. noch in der Aufbauphase des Dualen Systems in Deutschland, wandten
sich westdeutsche 10- bis 15-Jährige täglich 100 Minuten dem
Fernsehen zu. Im ersten Halbjahr 2000 sind unter den westdeutschen Jugendlichen
110 Minuten zu verbuchen.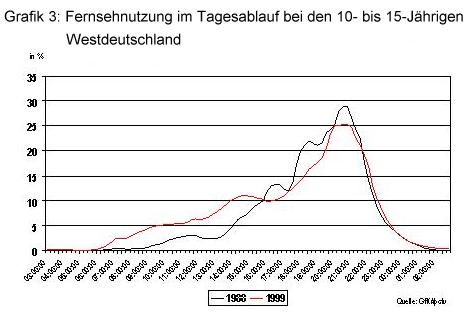 fern als Westdeutsche. Diese Diskrepanz zieht sich durch alle Altersgruppen.
Da sie sich bei den jüngsten und jüngeren Zuschauern eher
verstärkt als nivelliert, ist mit einer Angleichung der Sehgewohnheiten
in den nächsten Jahren kaum zu rechnen.
fern als Westdeutsche. Diese Diskrepanz zieht sich durch alle Altersgruppen.
Da sie sich bei den jüngsten und jüngeren Zuschauern eher
verstärkt als nivelliert, ist mit einer Angleichung der Sehgewohnheiten
in den nächsten Jahren kaum zu rechnen.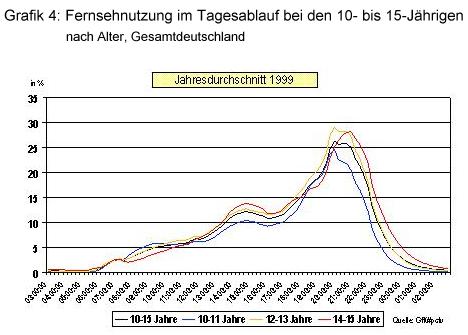 Dagegen taucht "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in der Hitliste der Jungen
zwischen 10 und 15 Jahren nicht einmal auf. Ihre Top 50 deckt ein wesentlich
breiteres Angebotsspektrum ab – von Sport-Live-Übertragungen über
Unterhaltungsshows bis hin zu Spielfilmen. Auffallend ist bei ihnen
die hohe Akzeptanz der Trickserie aus der "Pokémon-Welt". Vor
allem bei den 10- bis 15-jährigen Jungen in Ostdeutschland hat
sich die in RTL II ausgestrahlte Trickserie "Pokémon" inzwischen
zu einem der beliebtesten Regelangebote entwickelt.
Dagegen taucht "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in der Hitliste der Jungen
zwischen 10 und 15 Jahren nicht einmal auf. Ihre Top 50 deckt ein wesentlich
breiteres Angebotsspektrum ab – von Sport-Live-Übertragungen über
Unterhaltungsshows bis hin zu Spielfilmen. Auffallend ist bei ihnen
die hohe Akzeptanz der Trickserie aus der "Pokémon-Welt". Vor
allem bei den 10- bis 15-jährigen Jungen in Ostdeutschland hat
sich die in RTL II ausgestrahlte Trickserie "Pokémon" inzwischen
zu einem der beliebtesten Regelangebote entwickelt.